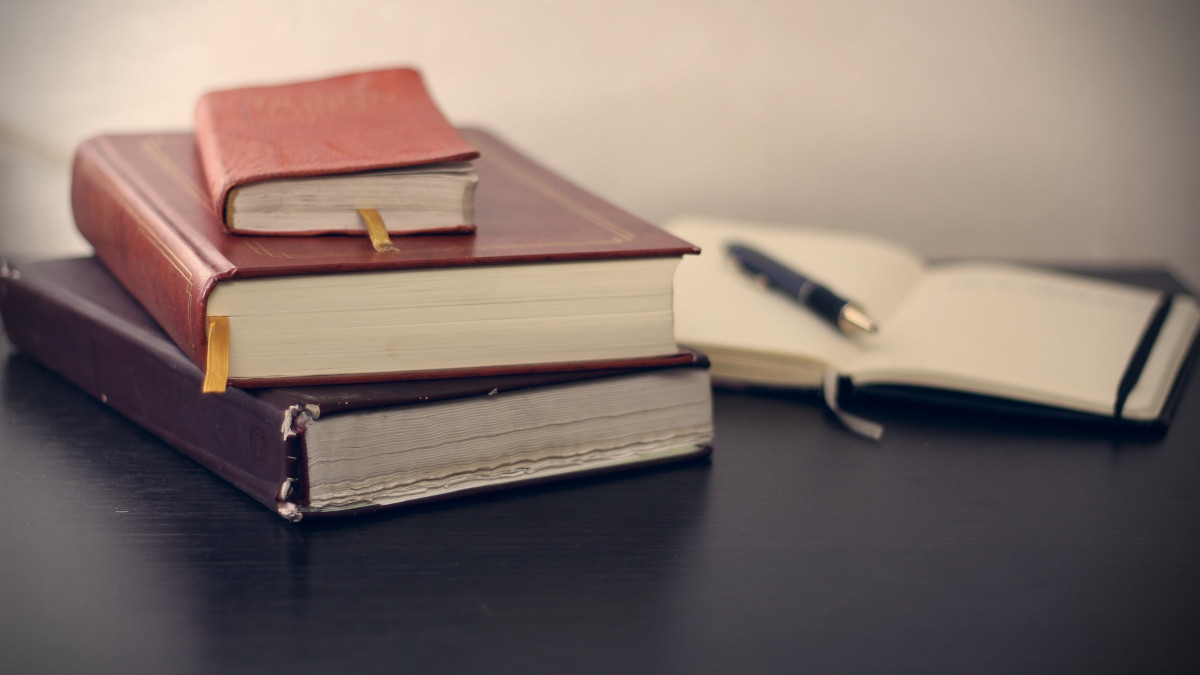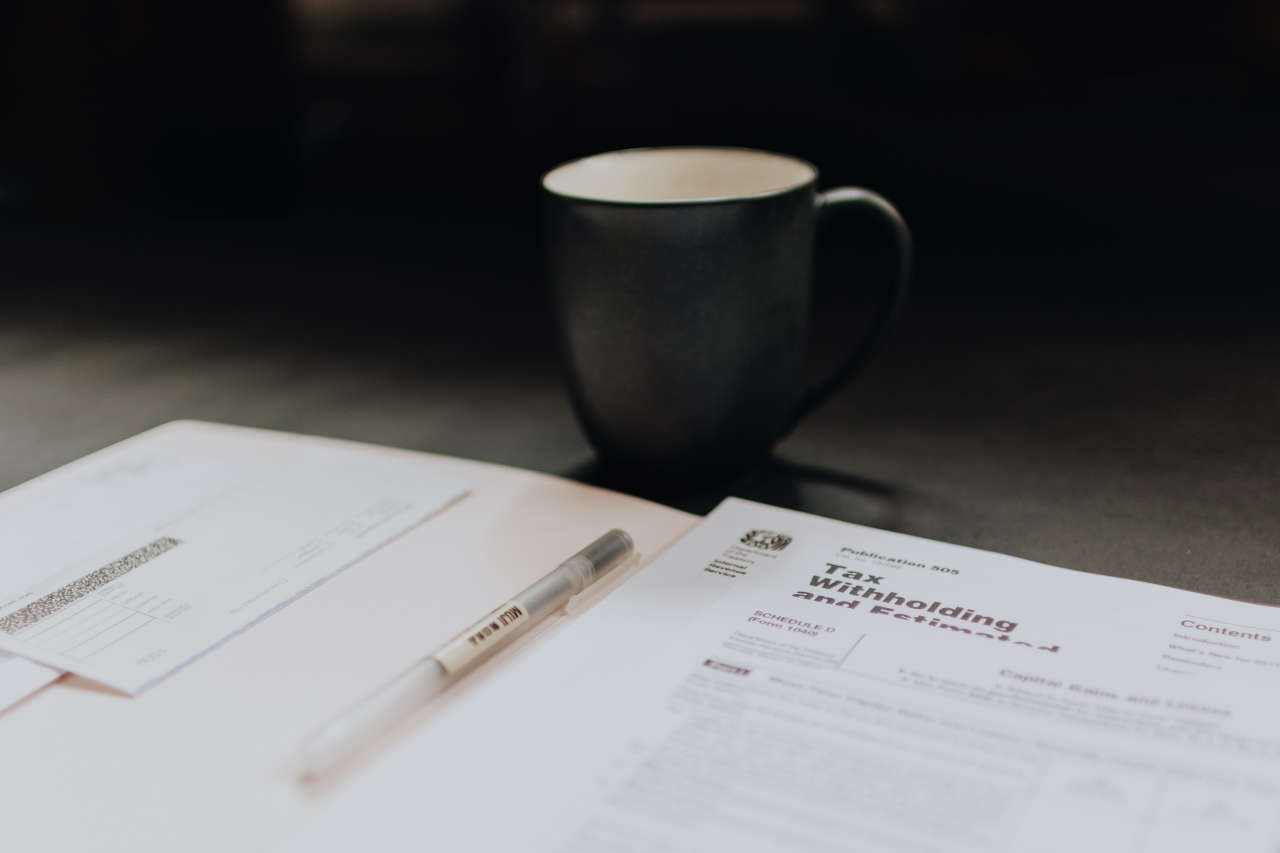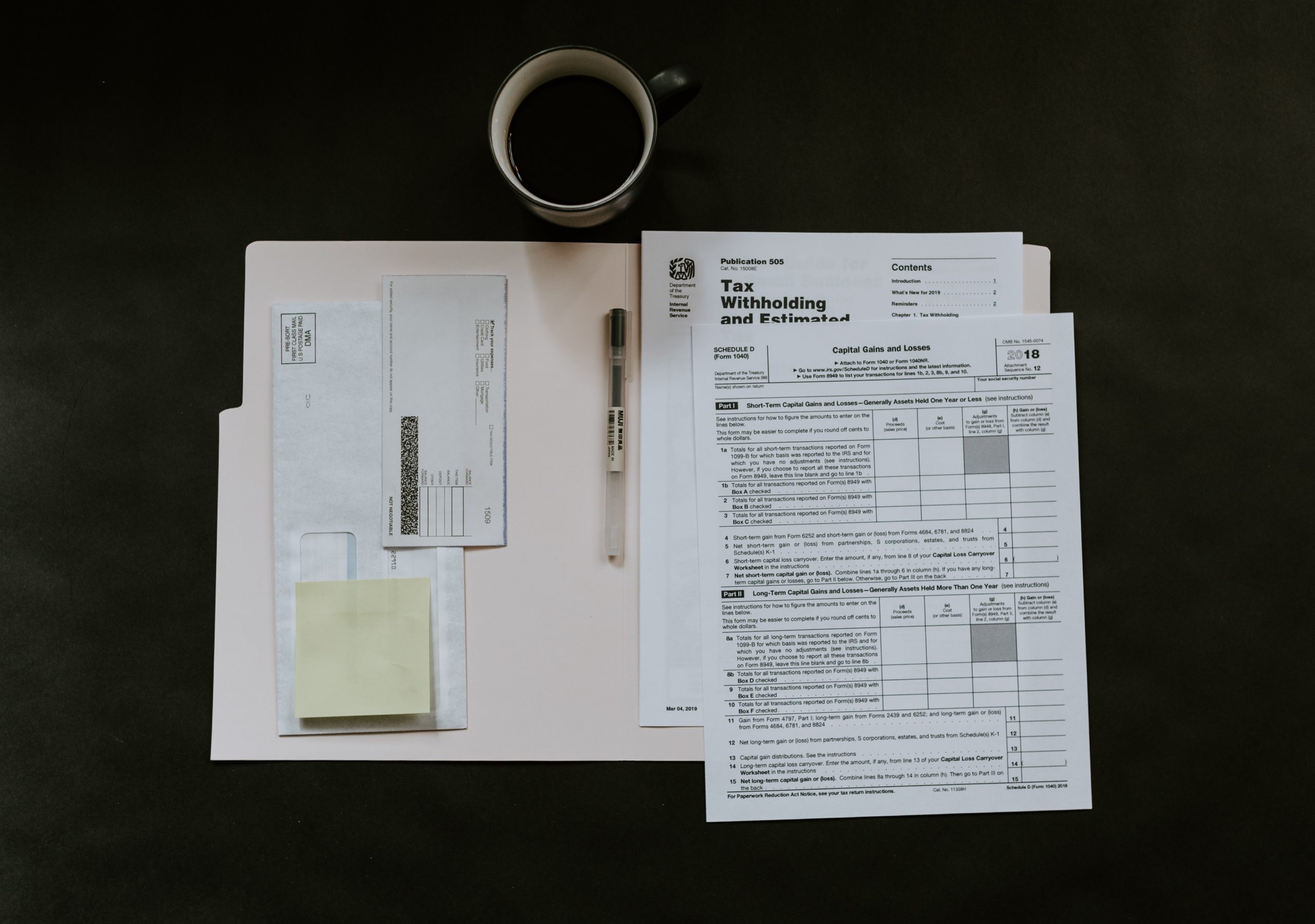Steuerentlastungen für gewinnstarke Unternehmen
Investitionsanreize durch neue Investitions- und
Gewinnfreibeträge
Das Bundesministerium für Finanzen kündigte vollmundig die „größte Steuerreform
aller Zeiten an” – jetzt ist sie da! Auf den ersten Blick wirken die kolportierten 18 Milliarden an Steuerentlastungen – in mehreren Etappen – tatsächlich imponierend. Andererseits verschärft die derzeit laufende hohe Inflation die kalte Progression und die Steuerpflichtigen geraten automatisch durch die nominellen Gehalts- und Einkommenserhöhungen in höhere Steuerklassen, weshalb unter dem Strich netto weniger vom brutto bleibt. Für den Fiskus stehen enorme Steuerbelastungen aus der kalten Progression für die Gegenfinanzierung zur Verfügung.
1. Die Tarifsenkung
Jeder soll von der Steuerreform profitieren – h entlastet werden. Die Steuerförderungen werden mit der sprichwörtlichen „Gießkanne” verteilt. Wie wichtig dem Fiskus die Gegenfinanzierung durch die kalte Progression ist, merkt man daran, dass die Tarifsenkung nur unterjährig erfolgen wird. Mit 1 Juli 2022 fällt zunächst die zweite Tarifstufe in der Einkommensteuer von 35 % auf 30 %. Die Stufe drei folgt ab Mitte 2023 und bringt eine Senkung von 42 % auf 40 %.1 Die Lohnverrechner sind Kummer gewohnt, der im Jahre 2022 ganzjährig gültige Mischsteuersatz von 32,5 % soll durch eine spätestens bis Mitte Mai 2022 durchzuführende Aufrollung entsprechend berücksichtigt werden und spätestens dann bei den Mitarbeitern auch durch eine höhere Nettozahlung an-kommen. Einkommensteuerpflichtige Unternehmer rechnen das gesamte Jahr mit dem Misch-satz von 32,5 % für 2022 und 41 % für das Jahr 2023.2 Für Körperschaften heißt es hingegen „bitte warten”. Ab der Veranlagung für 2023 sinkt der „flache” (proportionale) KöSt-Tarif von 25 % auf 24 %, ab der Veranlagung für 2024 von 24 % auf 23 %. Das Ziel der Tarifsenkungen, der Standort Österreich soll als Wirtschaftsstandort attraktiver werden.
2. Mehr Familienbonus für Kinderreichtum
Der sogenannte „Familienbonus plus” steigt – leider ebenfalls erst unterjährig ab 1. Juli 2022 von
EUR 1.500 auf EUR 2.000.3 Ab dem 18. Lebensjahr der Kinder erhöht sich der jährliche Familien-bonus plus von bisher EUR 500 auf EUR 650. 4 Da niedrig verdienende Steuerzahler von der Steuerermäßigung nicht profitieren können, steigt auch der Kindermehrbetrag als „Negativsteuer” stufenweise pro Kind und Jahr von derzeit EUR 250 (bis 2021) auf EUR 350 (2022) und EUR 450 (2023).5 Kinder erziehen wird vom Staat weiterhin mittels finanzieller Anreize gefördert. Österreich hat eine weltweit einzigartig hohe Kinderförderung, ob dies helfen wird, die „kinderproduktion” in Österreich zu erhöhen, steht freilich in den Sternen!
3. Investitionsfreibetrag ab 2023
Ältere Semester werden sich noch an den alten Investitionsfreibetrag erinnern – 2001 ist diese Steuerförderung für Investitionen ausgelaufen, jetzt wird sie wieder reaktiviert. Wer ungebrauchte Investitionsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens anschafft, kann 10 % der Anschaffungs-und Herstellungskosten als fiktive steuerliche Betriebsausgabe geltend machen – zusätzlich zur Abschreibung. Der Investitionsfreibetrag ist tatsächlich ökologisch ausgelegt: Für „Öko-Invest-ments” beträgt der Freibetrag sogar 15 %. Was sind „Öko-Investments”? Der Bundesminister für Finanzen soll zusammen mit dem Bundesministerium für Klimaschutz Investitionen im Wege einer Verordnung näher regeln.
Der neue IFB lässt sich für Wirtschaftsgüter beanspruchen, die nach dem 31. Dezember 2022 erworben werden. Für die investitionsfreudigen Unternehmer heißt es daher, neue Investitionen sorgfältig ab 1. Jänner 2023 gestalten. Aber Achtung, aktivierungspflichtige Teilherstellungskos-ten können bereits im Jahr 2022 anfallen, bei Herstellungen kommt es nämlich auf den finalen Fertigstellungstermin nach dem 1. Jänner 2023 an. Damit können Sie Teilinvestitionen bereits planen – ohne dass der gesamte Investitionsfreibetrag im gesamten Jahr verloren geht.
Die bilanzrechtliche Erfassung des Investitionsfreibetrages im Jahresabschluss ist fraglich, da die Bildung einer „unversteuerten Rücklage” nicht mehr zulässig ist. Die Erfassung in der Bilanz kann daher nur unter den „Gewinnrücklagen” erfolgen.” Ob darüber hinaus Erläuterungen (zB im An-hang) notwendig sind, wird vom Ergebnis des fachlichen Diskurses in der Zukunft abhängen.
4. GWG-Grenze ab 2023: EUR 1.000
Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgütern von derzeit EUR 800 auf EUR 1.000 steigt ebenfalls erst mit Stichtag 1. Jänner 2023.8 Die Erhöhung der Grenze bedeutet eine massive bürokratische Erleichterung für Unternehmer, da Wirtschaftsgüter unter dieser Grenze nicht mehr ins Anlagevermögen aufgenommen werden müssen.
In der Praxis bedeutet die Erhöhung der GWG-Grenze auch auf die wirtschaftliche Einheit zu ach-ten. Wirtschaftsgüter, die wirtschaftlich eine Einheit darstellen, dürfen nicht zwecks Erzielung eines Steuervorteils in ihre Einzelteile zerlegt werden, wenn sie in ihrer Gesamtheit eine wirtschaftliche Einheit bei der Verwendung darstellen. Beispiele für eine wirtschaftliche Einheit sind:°
• Besprechungstisch und Bestuhlung,
• Kino- und Theatersessel,
• Computer-Recheneinheiten,
• Möbelgarnitur-Sitzgruppe.
5. Mitarbeiterbeteiligungen
Nach alter Rechtslage musste man Mitarbeitern eine Beteiligung am Unternehmen gewähren, um in den Genuss einer Steuerfreiheit zu gelangen. Die Mitarbeiterbeteiligungsmodelle waren in der Vergangenheit “totes” Recht, da Unternehmen offensichtlich keine Mitsprache- und Kontrollrechte – auch wenn diese nur marginal waren – abgeben wollten. Mit der ökologischen Steuerreform wird eine steuerfreie Gewinnbeteiligung von Angestellten und Arbeitern am Erfolg des Unternehmens ermöglicht – ohne dass der geförderte Mitarbeiter eine gesellschaftsrechtliche Unternehmensbeteiligung erwerben muss. Die Befreiungen für Gewinnbeteiligungen ohne Beteiligungen gelten ab 1. Jänner 2022.
Die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg zu beteiligen, stellt allerdings einen großen Motivationsanreiz dar, zumal damit die Ziele des Unternehmers deckungsgleich mit den Zielen der Arbeitnehmer sind. Das Ziel der Mitarbeiterbeteiligung ist eine Absicherung und eine Erhöhung der liquiden Mittel beim Arbeitnehmer und vor allem soll die Bindung des Arbeitnehmers an sein Unternehmen gestärkt werden.
Eine gesetzliche Legaldefinition der Gewinnbeteiligung fehlt im Einkommensteuergesetz. Fraglich ist, welche “Zielerreichungsindikatoren” für den Anspruch der Prämie für die Arbeitnehmer herangezogen werden können, das Gesetz gibt darüber keinen Aufschluss. Die Orientierung am Gesamtunternehmenserfolg wird in vielen Praxisfällen offenkundig nicht sinnvoll sein, da der einzelne Mitarbeiter einen Gesamtunternehmenserfolg vielleicht nur unwesentlich beeinflussen kann.
Problematisch ist die schon an anderen Stellen des EStG normierte Voraussetzung, dass die Gewinnbeteiligung allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern zu gewähren ist. Die Abgrenzung der “bestimmten Gruppen” führte schon in der Vergangenheit zu zahlreichen rechtlichen Unsicherheiten und erhöht den Verwaltungsaufwand für die Wirtschaft.
Die Begünstigung soll maximal bis zu EUR 3.000 pro Arbeitnehmer betragen – so wie bisher bei Unternehmensbeteiligungen (diese bleibt unverändert bestehen). Die Steuerfreiheiten sind allerdings natürlich auch beim Arbeitgeber beschränkt. Die Summe aller gewährten Gewinnbeteiligungen dürfen die unternehmensrechtlichen Ergebnisse (EBIT) nicht übersteigen. Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechner oder für freiwillige Bilanzierer gelten die steuerlichen Vorjahreswerte. Werden die Grenzen überschritten, schlägt der Fiskus zu und die übersteigenden Zuwendungen sind einkommensteuerpflichtig.
6. Erhöhung des Gewinnfreibetrages
Der Grundfreibetrag – ohne Investitionserfordernis – steigt für Wirtschaftsjahre ab 1. 1. 2022 von bisher 13 % auf 15 % und betraglich somit von EUR 3.900 (13 % von EUR 30.000) auf EUR 4.500 (15 % von EUR 30.000). Der investitionsgebundene Gewinnfreibetrag wird auf Grund der prozentuellen Erhöhung ebenfalls erhöht. Wie bisher sind die ersten EUR 30.000 durch den Grundfreibetrag abgedeckt. Wenn steuerliche Gewinne über diesen Betrag erzielt werden, dann kann darüber hinaus in abnutzbaren Sachanlagen oder in bestimmten Wertpapieren investiert werden, um den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag zu lukrieren. Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag steht insoweit zu, als er durch die Anschaffungs- und Herstellungskosten gedeckt ist. Es stellt sich die Frage, ob es günstiger ist, den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag oder den Investitionsfreibetrag ab 2023 zu beantragen – beide Förderungen können nämlich kumulativ nicht beantragt werden. Wenn der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag auch durch den Kauf für bestimmte Wertpapiere genutzt werden kann, empfiehlt sich wahrscheinlich für Sachanlagen primär den Investitionsfreibetrag zu nutzen, insbesondere bei “Ökologischen-Investments” mit dem (erhöhten) 15 % Investitionsfreibetrag.
7. Neues Arbeitsplatzpauschale – groß oder klein?
Mittels Initiativantrag des Parlaments vom 19. 11. 2021 wurde die Einführung eines Arbeitsplatzpauschales beschlossen. Einkommensteuerpflichtige Unternehmer sollen ab 2022 pro Jahr bis zu EUR 1.200 als Betriebsausgaben absetzen können, wenn zur Ausübung der Tätigkeit kein anderer Raum zur Verfügung steht.
Die Höhe des Pauschales soll sich an der Höhe der zusätzlichen Erwerbseinkünfte ausrichten:
- Ein Pauschale in der Höhe von EUR 1.200 im Jahr soll zustehen, wenn keine anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit erzielt werden, für die den Selbständigen außerhalb der Wohnung ein anderer Raum zur Verfügung steht oder diese höchstens EUR 11.000 betragen.
- Ein Pauschale in der Höhe von EUR 300 im Jahr soll zustehen, wenn die Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit des Selbständigen, für die ihm außerhalb der Wohnung ein anderer Raum zur Verfügung steht, EUR 11.000 übersteigen. Neben diesem Pauschale sind nur Aufwendungen und Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) nach Maßgabe des § 16 Abs 1 Z 7a lit a zweiter und dritter Satz EStG zusätzlich abzugsfähig.
8. Achtung Gegenfinanzierung – Besteuerung von Einkünften aus Kryptowährungen
Die Änderungen auf den Punkt gebracht: Kryptowährungen unterliegen in Analogie zu Wertpapieren und sonstigen Kapitalanlagen dem Sondersteuersatz (Kapitalertragsteuer) in Höhe von 27,5 %. Eine Endbesteuerungswirkung ist sowohl für laufende Einkünfte – wie zB der Erwerb von “Kryptos” durch einen technischen Prozess (Mining) – als auch für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen aus den Unterschiedsbeträgen beim Kauf und Verkauf der Kryptowährungen normiert. Unentgeltlich erhaltene Kryptowährungen (sogenannte “airdrops”), welche gegen keine oder unwesentliche sonstige Leistungen (“bounties”) übertragen werden, stellen erst bei der Wiederveräußerung steuerpflichtige Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen dar.
Die Einkünfte aus den Kryptowährungen unterliegen einer Abzugspflicht, welche sich an inländische Dienstleister oder inländische Zweigstellen oder Betriebsstätten von ausländischen Dienstleistern richtet. Wenn zu Unrecht kein ordnungsgemäßer Steuerabzug direkt an der Quelle erfolgt, dann haftet der Dienstleister dem Fiskus für den Steuerausfall.
Es stellt sich natürlich die Frage, was alles unter “Kryptowährung” zu verstehen ist. Nach der gesetzlichen Legaldefinition ist “eine Kryptowährung eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann”.
Die Definition versursacht leider Rechtsunsicherheiten, weil viele Zweifelsfällen offenkundig nicht geklärt sind. Die gesetzliche Legaldefinition erscheint prima vista sehr weitreichend sein. Meines Erachtens könnten auch Zertifikate (Berechtigungsscheine) für materielle Wirtschaftsgüter unter die Legaldefinition fallen. Fraglich ist zudem die Behandlung von sogenannten “non-fungible-tokens” (NFT), welche nicht vertretbare Sachen (zB Kunstgegenstände) repräsentieren, die in der Praxis als Echtheitszertifikate von immateriellen Gütern verwendet werden. Da die Funktion eines Tauschmittels nicht dominierend ist, wird in der Fachliteratur vertreten, dass NFT nicht unter Kryptowährung iSd § 27 EStG fallen.
Kryptowährungen werden somit ab dem geplanten Zeitpunkt des Inkrafttretens mit 1. 3. 2022 wie “normale” Wertpapiere behandelt. Nach der bisher geltenden Rechtslage waren Einkünfte aus Kryptowährungen im privaten Bereich in der Regel nur einkommensteuerpflichtig, wenn die Spekulationsfrist von einem Jahr nicht eingehalten wurde. Insofern stellen die gesetzlichen Änderungen eine zusätzliche Einnahmenquelle für den Fiskus und damit verbunden eine Gegenfinanzierung für den Staat zur Finanzierung der ökologischen Steuerreform dar. Und Gewinne mit dem Handel von Kryptowährungen mit einer Behaltedauer von unter einem Jahr wurden oftmals am Fiskus “vorbeigeschummelt”, die Generierung von Schwarzeinkünften aus Kryptowährungen ist durch den Steuerabzug an der Quelle nun ebenfalls sehr erschwert.
9. Absenkung des Körperschaftsteuertarifes – bitte warten auf 2023 und 2024
Der proportionale KöSt-Tarif von derzeit 25 % wird im Kalenderjahr 2023 auf 24 % und im Kalenderjahr 2024 auf 23 % abgesenkt. So erfreulich für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich die Tarifsenkung der Körperschaftsteuer auch ist, der Wermutstropfen ist die lange Verzögerung für den Eintritt der Steuerentlastung. Unklar ist leider auch die Durchführung bei Wirtschaftsjahren mit abweichenden Bilanzstichtagen, weil § 26c Z 83 KStG eine gestaffelte Vorgehensweise normiert, eine Aufteilung des steuerpflichtigen Einkommens auf die einzelnen Kalenderjahre der wirtschaftlichen Entstehung somit zu erfolgen hat. Wie eine solche Aufteilung allerdings berechnet werden soll, lässt § 26c Z 83 KStG jedoch offen!
10. Pauschale Wertberichtigungen zu Forderungen
Mit dem “COVID-19-Steuermaßnahmengesetz” ist ein Steuerabzug für pauschale Wertberichtigungen zu Forderungen für Wirtschaftsjahre ab 1. Jänner 2021 zulässig. Liegt die wirtschaftliche Ursache des Wertberichtigungsbetrages in den Vorjahren, dann ist die pauschale Wertberichtigung gleichmäßig auf die folgenden vier Jahre zu verteilen.23 § 6 Z 2 lit a EStG idF BGBl 2021/3 ab 1. 1. 2021 normiert, dass “eine pauschale Wertberichtigung für Forderungen unter den Voraussetzungen des § 201 Abs 2 Z 7 des UGB idF BGBl I Nr. 22/2015 mit steuerrechtlicher Wirkung zulässig ist”. Die Anknüpfung an das Unternehmensrecht bewirkt, dass die unternehmensrechtlichen Vorschriften des § 201 Abs 2 Z 7 UGB auch zu den steuerrechtlichen Normen gehören. Voraussetzung für die Bildung im Unternehmensrecht ist, dass die Bilanzierung auf Basis von Schätzungen möglich ist. Schätzungen sind nach dem am besten geeigneten Verfahren vorzunehmen, wobei eine Beurteilung dann als angemessen einzustufen ist, wenn Schätzungen die aktuellsten verfügbaren Daten berücksichtigen und die Ermittlung auf einer objektiven Grundlage erfolgt. Statistisch ermittelte Erfahrungswerte aus vergleichbaren Geschäftsfällen sind daher die Basis für die Schätzungsgrundlage für die Ermittlung der pauschalen Wertberichtigungen. Keinesfalls dürfen willkürliche Wertansätze gewählt werden. Die pauschale Berechnung ist kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen zu runden. Basis für die Berechnung ist der Stand der nicht-einzelwertberichtigten Forderungen.
11. Pauschale Rückstellungen im Steuerrecht
Ebenfalls für Zeiträume ab dem 1. 1. 2021 bestimmt § 9 Abs 3 EStG idF “COVID-19-Steuermaßnahmengesetz”, dass steuerliche Rückstellungen auch pauschal gebildet werden dürfen. Für Zeiträume davor sind Rückstellungen mit steuerlicher Abzugswirkung nur zulässig, wenn konkrete Umstände nachgewiesen werden konnten. Das Steuerrecht knüpft auch hier an das Unternehmensrecht in § 201 Abs 2 Z 7 UGB an. Der Steuergesetzgeber lässt jedoch ausdrücklich nur pauschale Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu¸ weshalb pauschale Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften mit steuerlicher Abzugswirkung nicht zulässig sind. Für die pauschale Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten sind ebenfalls statistisch ermittelte Erfahrungswerte aus gleich gelagerten Sachverhalten erforderlich. Wenn der Sachverhalt der Rückstellungsbildung vor dem 1. 1. 2021 liegt, ist die Rückstellung zeitlich verlagert auf den folgenden vier Wirtschaftsjahren gleichmäßig zu verteilen. Unternehmensrechtlich – und damit verbunden auch steuerrechtlich – ist es zB anerkannt, eine pauschale Gewährleistungsrückstellung iHv zB 2 % der Umsatzerlöse zu bilden, wenn der Prozentsatz anhand der Gewährleistungsansprüche der Erfahrungswerte der Vorjahre ermittelt wurde.
12. CO2-Bepreisung und Klimabonus
Sie fragen sich, wo die ökologischen Themen bleiben. Den “Einstieg in den Umstieg” zum ökologischen Steuersystem bildet die Bepreisung von EUR 30 je verbrauchter CO2-Tonne ab 1. 7. 2022 und soll in Etappen bis 2025 auf EUR 55 je verbrauchter CO2-Tonne steigen. Auf der anderen Seite zahlt der Fiskus die Mehrbelastungen wieder mittels Klimabonus zurück. Naja… Vielleicht erkennen wir in einigen Jahren ja tatsächlich den Systemwechsel hin zu einem klimafreundlichen Steuersystem.
13. Kurz & Bündig
Die Steuerentlastungen durch Tarifsenkungen und in Anspruch genommene Investitionsförderungen treten nur zeitverzögert ein und werden teilweise durch neue bürokratische Anwendungserfordernisse und Gegenfinanzierungen kompensiert. Bei allen Unsicherheiten und Zweifelsfällen ist eines gewiss: Das Steuerrecht ist und bleibt kompliziert.